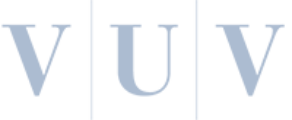Beratung
Die Beziehung zwischen Ihnen und unserem Berater ist die Basis. Das persönliche Gespräch ist das Medium und Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel.Verwaltung
Die Individuelle Vermögensverwaltung – der ultimative Vertrauensbeweis, den wir sehr ernst nehmen.Unsere Fonds
Über Fonds können Sie investieren wie die Profis.Nachhaltigkeit
Gutes Gewissen und Rendite schließen sich nicht aus.Seien Sie uns herzlich willkommen!
Nordlux Vermögensmanagement zählt mit über 2.000 Kunden und rund 40 Mitarbeitenden zu den großen privaten Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum in Luxemburg.
Unser Ziel ist, das Anlagekapital unserer Kunden bestmöglich zu investieren. Dazu nutzen wir den Finanzmarkt weltweit und können unter Inkaufnahme angemessener Risiken möglichst hohe Renditen erwirtschaften.
Wir selber betreiben keinen Eigenhandel, um jeden Interessenkonflikt auszuschließen.
Unsere Geschäftstätigkeit besteht aus Anlageberatung, der Individuellen Vermögensverwaltung und dem Fondsgeschäft.
Der Slogan „Echte Leistung – Ihr Partner in Luxemburg“ beinhaltet für uns zwei sehr wichtige Kernelemente:
- Kompetenz – nachweisbar und glaubwürdig – verbunden mit Resultaten
- Langfristig aufgebaute Kunden-Berater-Beziehungen – partnerschaftliches Vertrauen trotz räumlicher Distanz
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu unseren Fonds oder Anlageprodukten.
Top News:
Horizont Fonds der Nordlux unter den TOP Ten von Fonds professionell
- 26. März 2024
Aktuelles aus unserem Blog
In verschiedenen Interviews haben wir Ihnen einige unserer Mitarbeitenden vorgestellt. Gerne geben wir Ihnen nun einen Überblick, wie die einzelnen Bereiche zusammenarbeiten.
- 26. März 2024
Ist die Preisbildung an den Finanzmärkten rational oder nicht?
- 26. März 2024
Die neue, vergessene Steuer: „Vorabpauschale für Investmentfonds“
- 15. Januar 2024
Kennen Sie schon unseren Newsletter?
Wir freuen uns, wenn wir Ihnen quartalsweise unseren Newsletter per E-Mail senden dürfen.
Wenn Sie über Marktmeinungen, Trends und Analysen auf dem Laufenden bleiben möchten, melden Sie sich bitte hier an:
Weitere News
Wissenswertes aus dem Fondsbereich
StiftungsPartner PERSPEKTIVEN Ausgabe 01/23
- 22. Mai 2023
Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Performance eines Fonds und den Besitz von Autos der Fondsmanager? Und unten im Artikel finden Sie wie gewohnt unsere Marktprognosen
- 9. April 2024
Funktionsweise eines Discount-Zertifikates
Unser Kollege Herr Wolfram Zimpel erklärt Ihnen das Discount Zertifikat.
Anlehnung an Experten
Kooperation mit imug rating
Erfahren Sie über unsere Zusammenarbeit mit der imug Beratungsgesellschaft in deren neuestem Newsletter.
UN Global Compact

Qualität auf ganzer Linie
Nordlux Vermögensmanagement ist vielfach ausgezeichnet.